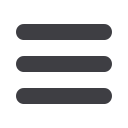
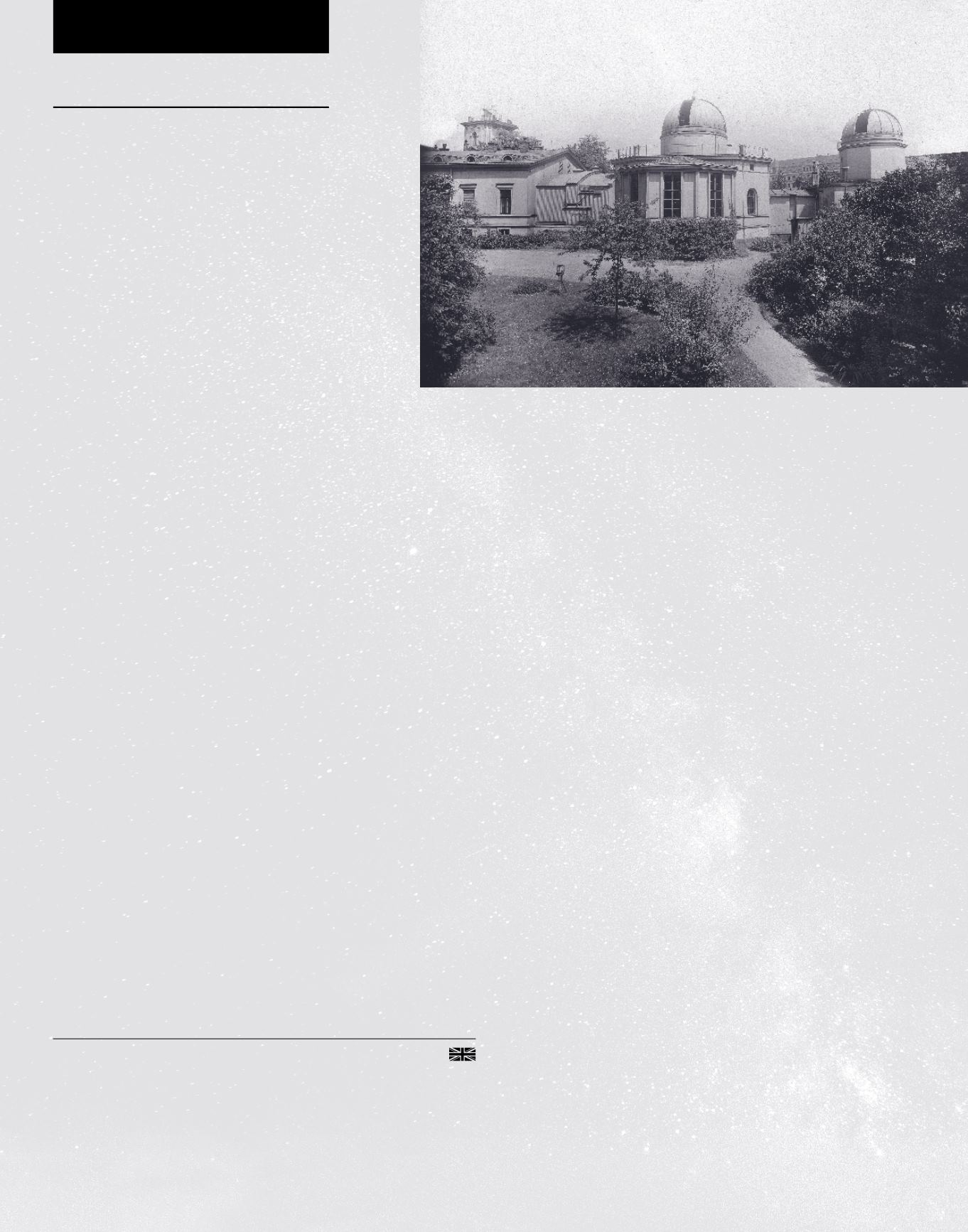
BAUTEN
20
A L U M N I — 2 018
Das Leipziger Institut für Meteorologie (LIM) in der
Stephanstraße fällt mit seinem zweigeschossigen Turm
gleich ins Auge. Was viele nicht wissen: Das markante
Haus wurde ursprünglich als eines von mehreren Neben-
gebäuden der damaligen Universitätssternwarte errichtet.
Von 1790 bis 1861 befand sich die Sternwarte der
Universität auf dem Turm der Pleißenburg, erwies sich je-
doch zunehmend als untauglich. Es fehlte eine Wohnung
für den Direktor der Sternwarte und die dichte Bebauung
behinderte die Himmelsbeobachtung durch Stadtbe-
leuchtung, Erschütterungen und Luftverschmutzung. Ein
Neubau musste her.
Das Baugrundstück lag im Johannistal und hatte
zuvor das Munitionslager der Stadt beherbergt. Man ent-
schied sich für diesen stadtnahen Standort, weil die Stern-
warte auch dem Lehrbetrieb dienen sollte und man den
Studenten keinen längeren Weg zumuten wollte. Stern-
wartendirektor Karl Christian Bruhns (1830–1881) ori-
entierte sich in seinem Bauprogramm an den astronomi-
schen Warten in Berlin, Bonn und Gotha und konzipierte
so die zu diesem Zeitpunkt modernste deutsche Sternwar-
te. Architekt des ebenerdigen und erschütterungsresisten-
ten Bauwerks war Albert Geutebrück (siehe Seite 30).
Nach knapp einem Jahr Bauzeit wurde die neue
Universitätssternwarte am 8. November 1861 eröffnet.
Die Stephanstraße gab es damals noch nicht, so dass sich
das Ensemble inmitten der Kleingartenanlage im Johan-
nistal befand. Ihr 7,5 Meter hoher, drehbarer Turm war
von einem achteckigen Korridor mit begehbarem Dach
umgeben. Daneben stand das zweigeschossige Direkto-
renhaus im klassizistischen Stil. Der große Meridiansaal
zur Himmelsbeobachtung lag im dazwischenliegenden
Verbindungsbau und beherbergte bei der Eröffnung ein
zwölffüßiges Fernrohr mit 3,9 Meter Brennweite und 215
Millimeter Öffnung. Dass die Anlage durchaus auch zur
Repräsentation bestimmt war, bewies nicht zuletzt der
gut gepflegte Garten.
Von den 1860er bis 1890er Jahren wurde der Stern-
wartenkomplex immer wieder erweitert und modernisiert.
Mehrere Nebengebäude kamen hinzu. Die drehbaren
Turmteile aus Holz wurden durch Stahlkonstruktionen
ersetzt und die trommelförmigen Aufbauten wichen halb-
kugelförmigen Kuppeln mit aufschiebbaren Öffnungen.
Inzwischen war auch die Stephanstraße angelegt wor-
den und die Stadt mit ihren Bauten unmittelbar an das
Grundstück der Sternwarte herangerückt.
1880/81 wurde ein weiteres Nebengebäude errichtet,
wegen seines 20 Meter hohen Turms auch als „Turmhaus“
bezeichnet. Es war als Meteorologische Warte konzipiert,
wurde aber lange Zeit nicht als solche genutzt. Als einzi-
ges blieb es von der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ver-
schont. Alle anderen Bauten fielen dem Bombenangriff am
4. Dezember 1943 zum Opfer – auch die Sternwarte wurde
zerstört und nie wieder aufgebaut. Nach dem Krieg bezog
der Fachbereich Geophysik das Turmhaus. Seit 1993 be-
herbergt dieser Teil der ehemaligen Sternwarte nun das
Leipziger Institut für Meteorologie und erfüllt somit heute
seinen ursprünglich vorgesehenen Zweck. Es ist geplant,
das Gebäude in den kommenden drei Jahren vollständig
zu sanieren und durch einen Neubau zu erweitern.
Nina Vogt, mit Auszügen aus:
Fibich, Peter. Sternwarte der Universität Leipzig,
Stephanstraße 3. Bauhistorische Recherche
im Auftrag des SIB Leipzig II. Freiraumkonzepte GbR:
Bad Lausick, 2015. (unveröffentlicht)
Der forschende
Blick zum
Himmel
Auf dem Gelände der
ehemaligen Universitätssternwarte
forschen heute Meteorologen
The Leipzig Institute for Meteorology (LIM) in Stephanstraße immediately
attracts attention thanks to its two-storey tower. What many people don‘t know,
however, is that the distinctive building was constructed in the 19th century
as one of many annexes to the former university observatory,
which was destroyed in World War Two.
Die Universitätssternwarte
zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts: Auf der linken
Seite ist im Hintergrund
das „Turmhaus“, heute Sitz
des Leipziger Instituts für
Meteorologie, zu erken-
nen. (Foto: Universitäts
archiv Leipzig)
















